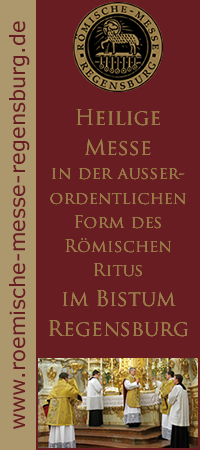Ihre Suchergebnisse für Georg May
Mainz (kathnews-exklusiv). Wie kathnews bereits ausführlich berichtete, wurde der renommierte Kirchenrechtler Professor Dr. Georg May von Papst Benedikt XVI. zum Apostolischen Protonotar ernannt. Heute sprach kathnews-Chefredakteur Benjamin Greschner mit dem Prälaten über sein pastorales und wissenschaftliches Wirken und die Verleihung des päpstlichen Ehrentitels. Gleich zu Beginn des Gesprächs zeigte sich Professor May überrascht über die Ernennung: „Ich habe diese Ehrung weder beantragt, noch angeregt. Sie ist ohne mein Zutun zu mir gekommen“, so der Geistliche. Für ihn ist klar, dass er sich auf dieser besonderen päpstlichen Auszeichnung nicht ausruhen wird: „Die Ehrung ist für mich ein Ansporn, meinen Dienst in der Kirche und in der Wissenschaft noch selbstloser und lauterer als bisher zu verrichten.“
Gleichzeitig versteht Professor May die Ernennung zum Apostolischen Protonotar nicht allein als eine Ehrung für sich selbst, sondern auch für die Gläubigen, die bei ihm die Heilige Messe besuchen: „Ich nehme die Ehrung an als eine Auszeichnung für meine Gemeinde, wie es im Kriege üblich war, Tapferkeitsmedaillen als Anerkennung für die Treue der einem Offizier unterstellten Männer anzusehen.“ Die Gläubigen seiner Gemeinde hätten ihn stets getragen, ermuntert und getröstet, so der Prälat weiter. „Ich hätte in den vielen Jahren, ja Jahrzehnten, meinen Dienst nicht verrichten können, ohne die opferwillige Begleitung der Gläubigen“, betont Hochwürden May.
Doch wie verändert die Ernennung zum Apostolischen Protonotar das priesterliche Leben und Wirken des Theologen? Für Prälat May keine Frage: „Ich werde selbstverständlich von dem Titel keinen Gebrauch machen und bleibe nach wie vor Priester – das ist mein möchster Beruf – und natürlich Professor, das heißt Zeuge der christlichen und katholischen Wahrheit!“
Geboren wurde Georg May am 14. September 1926 in Liegnitz in Schlesien. Nach dem II. Weltkrieg studierte er Theologie und Philosophie. Am 1. Mai 1951 empfing May das Sakrament der Priesterweihe für das Erzbistum Breslau. Es folgten weitere Studien in deren Verlauf der junge Priester promovierte und habilitierte. Seine Lehrtätigkeit begann May an der Universität in Freiburg, bevor er dann 1960 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz den Lehrstuhl für kanonisches Recht, Staatskirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte übernahm. Bis 1994 hatte Professor May diesen Lehrstuhl inne.
Foto: Professor Georg May – Bildquelle: gloria.tv
Mainz/Vatikan (kathnews-exklusiv). Grund zur Freude hat in diesen Tagen der renommierte Theologe und Kirchenrechtler Professor Georg May: Wie kathnews exklusiv aus ranghohen Kirchenkreisen erfuhr, wird Papst Benedikt XVI. ihm in Kürze den Titel eines Apostolischen Protonotars verleihen. Dieser Titel ist der höchste Ehrenprälatentitel. Die Ernennung Mays zum Apostolischen Protonotar soll, wie kathnews weiter erfuhr, auf Vorschlag des Regensburger Bischofs Gerhard Ludwig Müller erfolgen und nicht, wie es eigentlich üblich wäre, auf Vorschlag des Diözesanbischofs, in dessen Diözese der zu Ehrende inkardiniert bzw. tätig ist – in diesem Fall wäre dies Kardinal Karl Lehmann als Bischof von Mainz. Wie kathnews erfuhr, sei die Ernennungsurkunde bereits durch den Heiligen Vater Papst Benedikt XVI. unterzeichnet, allerdings noch nicht überreicht worden.
Mit der Ernennung Professor Mays zum Apostolischen Protonotar ist eine große Signalwirkung für die kirchliche Tradition in Deutschland verbunden. Hochwürden May gilt seit vielen Jahren als deutlicher Kritiker der nachkonziliaren Entwicklung in Theologie und Liturgie und zählt zu den größten Freunden und Förderern der liturgischen Tradition der Kirche. Der Priester, der 1926 im schlesischen Liegnitz geboren wurde, feiert regelmäßig in seiner Wahlheimat Budenheim die heilige Messe in der außerordentlichen Form des römischen Ritus.
Aus seinem Leben
Nach dem II. Weltkrieg studierte Georg May Theologie und Philosophie. Am 1. Mai 1951 empfing May das Sakrament der Priesterweihe für das Erzbistum Breslau. Es folgten weitere Studien in deren Verlauf der junge Priester promovierte und habilitierte. Seine Lehrtätigkeit begann May an der Universität in Freiburg, bevor er dann 1960 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz den Lehrstuhl für kanonisches Recht, Staatskirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte übernahm. Bis 1994 hatte Professor May diesen Lehrstuhl inne.
Foto: Professor Georg May – Bildquelle: gloria.tv
Mainz (kathnews-exklusiv). Bereits im Dezember berichtete kathnews.de exklusiv, dass die Ernennung von Professor Dr. Georg May zum Apostolischen Protonotar unmittelbar bevorsteht. Die Ernennung sollte, wie kathnews damals aus zuverlässiger Quelle erfuhr, auf Vorschlag von Bischof Gerhard Ludwig Müller von Regensburg erfolgen und nicht, wie es eigentlich üblich wäre, auf Vorschlag des Diözesanbischofs, in dessen Diözese der zu Ehrende inkardiniert bzw. tätig ist – in diesem Fall wäre dies Kardinal Karl Lehmann als Bischof von Mainz. Nun liegt der kathnews-Redaktion exklusiv das dazugehörige Schreiben des Bischofs von Regensburg vor, mit dem er Professor May offiziell zu dessen Ernennung zum Apostolischen Protonotar gratulierte und ihm die päpstliche Ernennungsurkunde zukommen ließ.
Verkündigung des unverkürzten katholischen Glaubens
In seinem Schreiben an Professor Dr. May erklärt Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, dass es ihm eine „Ehre und Freude“ sei, dem Priester die Ernennungsurkunde zum Apostolischen Protonotar zukommen lassen zu können. Anschließend geht der Bischof würdigend auf das Engagement und Lebenswerk des Professors ein. „Zu dieser hohen Auszeichnung, mit der die Kirche ihre Wertschätzung für Ihr jahrzehntelanges akademisches und pastorales Wirken, Ihr standhaftes sentire cum ecclesia und Ihre gewissenhafte Verkündigung des unverkürzten katholischen Glaubens zum Ausdruck bringt, gratuliere ich Ihnen sehr herzlich.“, so Bischof Gerhard Ludwig Müller wörtlich.
Stärkung der Tradition in Deutschland
Mit der Ernennung Professor Mays zum Apostolischen Protonotar ist eine große Signalwirkung für die kirchliche Tradition in Deutschland verbunden. Hochwürden May gilt seit vielen Jahren als deutlicher Kritiker der nachkonziliaren Entwicklung in Theologie und Liturgie und zählt zu den größten Freunden und Förderern der liturgischen Tradition der Kirche. Seitens des Bistums Mainz gab es bislang keine offizielle Stellungnahme zur Ernennung Georg Mays zum Apostolischen Protonotar.
Professor May: Ein Leben für die Kirche
Nach dem II. Weltkrieg studierte Georg May Theologie und Philosophie. Am 1. Mai 1951 empfing May das Sakrament der Priesterweihe für das Erzbistum Breslau. Es folgten weitere Studien in deren Verlauf der junge Priester promovierte und habilitierte. Seine Lehrtätigkeit begann May an der Universität in Freiburg, bevor er dann 1960 an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz den Lehrstuhl für kanonisches Recht, Staatskirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte übernahm. Bis 1994 hatte Professor May diesen Lehrstuhl inne.
kathnews-exklusiv: Klicken Sie hier um den Brief von Bischof Gerhard Ludwig Müller an Prälat Georg May zu öffnen!
Der glaubenskonservative Professor und Prälat Dr. Georg May kann heute sein 90. Wiegenfest feiern, wozu wir ihm herzlich gratulieren, alles Gute und Gottes reichen Segen wünschen. Der katholische Theologe und Kirchenrechtler ist am 14. September 1926 in Liegnitz (Schlesien) geboren. Er lehrte jahrzehntelang an der Universität Mainz Kirchenrecht und kirchl. Rechtsgeschichte. Er lebt in Budenheim bei Mainz und schreibt nach wie vor an weiteren Büchern und Veröffentlichungen.
Auf Anregung von Kardinal Gerhard Müller wurde der Priester und Gelehrte im Jahre 2011 von Papst Benedikt zum Apostolischen Protonotar ernannt. Prof. Georg May publizierte zahlreiche Werke zu liturgischen, kirchengeschichtlichen und kanonischen Themen, darunter ein umfangreiches Sachbuch über die Verfolgung der katholischen Kirche unter der nationalsozialistischen Diktatur. Der Prälat äußerte sich in Vorträgen und Veröffentlichungen kritisch zur Liturgiereform bzw. positiv über die überlieferte hl. Messe. Er befaßte sich ohne Umschweife mit dem Niedergang des Glaubens vor allem in den deutschsprachigen Ländern – und mit der weitgehenden Nichtbeachtung des kirchlichen Wächteramts durch die Hierarchie.
Zurück zur päpstlichen Ehrung für Prof. May: Die Ernennungs-Urkunde zum Protonotar übersandte ihm der damalige Regensburger Bischof Gerhard Müller, heute vatikanischer Glaubenspräfekt, auf dessen Vorschlag hin die Würdigung erfolgte. In seinem Begleitbrief schrieb Müller: „Zu dieser hohen Auszeichnung, mit der die Kirche ihre Wertschätzung für Ihr jahrzehntelanges akademisches und pastorales Wirken, Ihr standhaftes sentire cum ecclesia und Ihre gewissenhafte Verkündigung des unverkürzten katholischen Glaubens zum Ausdruck bringt, gratuliere ich Ihnen sehr herzlich.“ In seiner Schrift „Die andere Hierachie“, die 1997 erschien, erklärt der Kirchenrechtler Folgendes:
„Es ist eine offenkundige und unbestreitbare Tatsache: Die Bischöfe sind die Hauptverantwortlichen für den unaufhörlichen dramatischen Niedergang der Kirche. Selten in der Geschichte hat eine Führungsschicht in so ungeheurem Ausmaß versagt wie die Mehrheit des Bischofskollegiums nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
Um es genau zu sagen: Die deutschen Bischöfe haben sich als unfähig erwiesen, die letztlich entscheidenden Aufgaben der katholischen Kirche in Deutschland adäquat zu lösen: den Glauben zu erhalten und zu verbreiten, die Sitten zu heben und zu bessern, den Gottesdienst zu fördern und zu schützen.“
Foto: Bischöfe – Bildquelle: Kathnews
Georg May ist eine der markantesten Priesterpersönlichkeiten und Gelehrten des deutschsprachigen Raumes in der Gegenwart. In diese Stellung gelangte der arrivierte Kanonist und Emeritus der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität vollends vor allem in der unmittelbaren Nachkonzilszeit und seither, da er nicht wie manch anderer aus Rücksicht auf mögliche, künftige Karriereaussichten davor zurückwich, sich durch luzide Kritik an den Entwicklungen auf und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hervorzutun und dabei konsequent an als „vor-konziliar“ abqualifizierten Maßstäben festzuhalten. Mittlerweile hat er das 90. Lebensjahr überschritten, ist also bereits von seiner Lebensspanne her als Zeitzeuge ausgewiesen.
Ähnlich wie Kardinal Domenico Bartolucci (1917-2013), dem noch von Pius XII. auf Lebenszeit ernannten Leiter des Chors der Sixtinischen Kapelle, hielt und hält May durchgehend und ausschließlich an der überlieferten Römischen Liturgie fest, ohne sich dazu jemals auf ein Indult oder Motu proprio berufen zu haben. Als Benedikt XVI. 2010 Bartolucci zum Kardinal kreiierte, schien der Purpur auch für May realistisch. Menschlich, priesterlich und akademisch hätte ihm May mit seinem Lebenswerk zweifelsohne ebenfalls voll entsprechen können. Benedikt XVI. würdigte dieses, indem er May 2011 in die höchste Prälatenklasse aufnahm und zum Apostolischen Protonotar supra numerum erhob.
Die Schrift: „Die alte und die neue Messe. Die Rechtslage hinsichtlich des Ordo Missae“ ist die Buchform einer Aufsatzreihe, die ursprünglich von 1975 bis 1976 in der Una Voce Korrespondenz erschienen ist. Mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors hat der Sarto-Verlag 2015 einen vollständig unveränderten Nachdruck herausgebracht, in dem selbst die damalige Orthographie beibehalten ist, was heutzutage einen eigenen, zusätzlich ästhetischen Lesegenuss zur Lektüre beiträgt. Der immense Wert dieser Neuauflage, die ich heute, auf den Tag genau 53 Jahre nach der Eröffnung des Zweiten Vaticanums vorstelle, indes ist der eines unbestechlichen, historischen Dokuments. Der Verzicht auf jegliche Aktualisierung unterstreicht es. Die Studie entstand unter den tatsächlichen Umständen der Durchführung und Umsetzung „der sogenannten Liturgiereform“, wie May, soweit ich sehe, durchgängig formuliert.
Prinzipiell ist der insgesamt positive, praktisch-konkrete Effekt des Motu Proprio Summorum Pontificum nicht zu leugnen, doch die darin vorausgesetzte Vorstellung, bereits Paul VI. hätte nur einen alternativen, neuen Ritus neben den alten setzen wollen, wird von Georg Mays Untersuchung überzeugend widerlegt. Die Überzeugungskraft dieser Widerlegung ist umso schlagender, als die damals entwickelte Argumentation nicht im Horizont einer solchen These entstand, sondern sich mit harten Fakten und Erfahrungswerten der tatsächlichen Praxis auseinandersetze. Nun behaupte ich nicht, Joseph Ratzinger würde Paul VI. ernsthaft die Absicht zuschreiben, eine gleichberechtigte Koexistenz von altem und neuem Ritus zu begründen, doch sachlich ist diese Annahme (oder Behauptung) offensichtlich die Grundlage für Benedikt XVI.‘ Konzeption, von einer älteren und einer neueren Ausdrucksform ein und desselben Römischen Ritus auszugehen und beide kirchenrechtlich als forma extraordinaria und forma ordinaria aufzufassen.
Vollständige Gleichrangigkeit erreicht man so nicht. Dem sogenannten ordentlichen Usus kommt ganz klar Vorrang zu. Doch es ist auch evident, dass Benedikt XVI. nicht eine solche Gleichrangigkeit erreichen wollte, sondern durch anachronistische Rückprojektion seiner These auf Paul VI. dessen sogenannte Liturgiereform und deren Verbindlichkeit nachträglich legitimieren wollte. Dies wohl in dem vollen Bewusstsein, dass Rechtmäßigkeit und Verbindlichkeit des Novus Ordo Missae im Lichte der faktischen historischen Umstände seiner Einführung und Durchsetzung, wie sie von May in der hier vorgestellten Untersuchung damals mustergültig dokumentiert wurden, auf tönernen Füßen stehen.
Beim Erlass von Summorum Pontificum in der Position des höchsten kirchlichen Gesetzgebers, konnte Benedikt XVI. die Einheit und Zweigestaltigkeit des Römischen Ritus juristisch verbindlich festschreiben, die Faktenlage der Geschichte ungeschehen machen oder umschreiben, konnte und kann Ratzingers These jedoch nicht. May dazu unmissverständlich: „Die nicht aufhörenden Versuche, den Papst (also Paul VI., Anm. C.V.O.) als Anwalt für die Beibehaltung des sogenannten tridentinischen Ritus in Anspruch zu nehmen, sind illusorisch“ (May, G., Die alte und die neue Messe. Die Rechtslage hinsichtlich des Ordo Missae, (Sarto), Stuttgart 2015, S. 67). Ein paar Seiten weiter fährt er fort: „In der Instruktion vom 20. Oktober 1969 zeigte sich zum erstenmal eine gewisse Rücksichtnahme auf die Priester, die ja die veränderte Messe in erster Linie betraf. Die Oberhirten sollten älteren Priestern, die ernste Schwierigkeiten bei der Verwendung des geänderten Ordo Missae, der geänderten Texte des Missale Romanum und der geänderten Leseordnung hatten, gestatten dürfen, die im Gebrauch befindlichen Riten und Texte weiterhin zu benutzen. Diese Ermächtigung unterlag jedoch einer schwerwiegenden Einschränkung. Sie durften die Erlaubnis nur Priestern geben, die die Messe ohne Volk zelebrieren (Nr. 19). Damit war der begünstigte Kreis sehr eng gezogen. Er umfasste nur Priester vorgerückten Alters, die privat zelebrieren. Dem Volk sollte die Messe Pius‘ V. offensichtlich zur Gänze und unwiderruflich entzogen werden“ (ebd., S. 69f).
Wir sehen: Ein numquam abrogatam wie von Benedikt XVI. postuliert, findet sich bei Paul VI. nicht. An eine Koexistenz zweier Ausprägungen eines Ritus war mittel- und erst recht langfristig nicht gedacht, geschweige denn war sie beabsichtigt. Der tridentinische Ritus sollte nur noch für Privatmessen weiterbenützt werden können, das heißt für solche Messen, die zumindest nicht ausdrücklich für das Volk gefeiert werden, also zum Beispiel nicht bei Messen einer Pfarrei, die im Pfarrbrief stehen, auch wenn an sich Gläubige immer an einer Privatmesse teilnehmen können. Wir kennen genug Fälle, wo das zudem nicht der Fall war, sondern diese Messen nur hinter verschlossener Tür geduldet wurden. Außerdem konnten nur alte oder kranke Priester in den Genuss der Weiterbenützung des bisherigen Römischen Ritus kommen. Anders gesagt und auf den Punkt gebracht: Die alte Messliturgie war Auslaufmodell, mit den alten und kranken Priestern, die sie übergangsweise noch verwenden durften, sollte der tridentinische Ritus aussterben. Jedenfalls wären Priester, die bereits 1969 „alt und krank“ waren, heute und auch schon 2007, als Benedikt XVI. Summorum Pontificum veröffentlichte, mehrheitlich bereits längst tot oder zumindest zwischenzeitlich verstorben.
Georg May beschränkt sich in seinen Darlegungen bewusst auf den Ordo Missae, also auf die gleichbleibenden Teile der heiligen Messe. Diese Selbstbegrenzung verdichtet und konzentriert das behandelte Problem, so dass es besser greifbar wird. Der Zugang ist der eines Kirchenrechtlers, und an dieser Stelle möchte ich betonen, dass die Schilderung zum Verständnis trotzdem keinen juristischen Hintergrund beim Leser voraussetzt. Gerade für solche, die die damalige Periode und ihre Ereignisse nicht selbst bewusst miterlebt haben, ist ihre Beschreibung meisterhaft anschaulich und streckenweise fesselnd zu lesen. Hier merkt man die große didaktische Erfahrung des Professors ebenso wie die seelsorgliche Nähe des Priesters auch zum theologisch und kirchenrechtlich oder dogmatisch nicht vorgebildeten Gläubigen.
Der Autor benutzt stets eine vornehme, höfliche, doch nicht minder deutliche Diktion: „Das Unbehagen und der Widerstand wacher und gläubiger Katholiken gegen die geänderte Liturgie der Meßfeier ließen sich in den vergangenen Jahren trotz unaufhörlicher Propaganda und pausenloser Indoktrination, trotz Druck und Drohungen, nicht unterdrücken. Die kirchliche Autorität (…) trat gegen die Kritiker der neuen Messe mit einer Schärfe auf, die, würde sie auf anderen Gebieten angewandt, ihr von den Vertretern der progressistischen Partei den (schwerwiegenden) Vorwurf eines Rückfalls in vorkonziliare Verhaltensweisen eintragen würde“ (ebd., S. 77f).
May scheut sich nicht, die Verbindlichkeit und den Verpflichtungsgrad der neuen Liturgie unter dem Blickwinkel zu prüfen, mit dem Missale Romanum Pauls VI. möglicherweise einem ungerechten Gesetz gegenüber zu stehen und gelangt zu einem affirmativen Befund (vgl. insbesondere ebd., S. 113-117, jedoch auch S. 119-134): „Die Priester und Gläubigen dürfen das Gesetz, das die Benutzung des Ordo Missae Pauls VI. vorschreibt, unbeachtet lassen, sie dürfen ihn verwenden, falls die bei Nichtbenutzung eintretenden Schäden größer wären, also beispielsweise Priester bei Nichtbenutzung sicher ihre Stelle verlieren würden und dadurch ihre Gläubigen entweder verwaist oder einem progressistischen ‚Gemeindeleiter‘ ausgeliefert sähen (ebd., S. 115). Aus heutiger Perspektive kann man nach der Lektüre von Mays Buch an dieser Stelle einfügen, dass der Novus Ordo Missae in den Jahrzehnten seiner Benützung seit seiner Einführung, dort, wo man wirklich bestrebt war, ihn in Übereinstimmung mit dem Glauben der Kirche und ihrer Liturgischen Überlieferung zu verwenden, vielleicht eine gewisse Legitimität hinzugewonnen hat, die er formal und ursprünglich nicht besaß. Doch eine Verpflichtung, ihn zu benutzen oder bei Unerreichbarkeit der überlieferten Liturgie auch im Novus Ordo die Sonntagspflicht erfüllen zu müssen (!), kann daraus nicht abgeleitet werden.
Wäre es zu einer Reform der Reform à la Ratzinger gekommen, hätten aber eventuell einzelne Details, die sich in der neuen Liturgie wirklich bewährt haben, wie zB die eine oder andere zusätzliche Präfation, in die überlieferte Liturgie von 1962 oder langfristig wieder in einen einheitlichen, gemeinsamen, genuin traditionskonformen Ritus aufgenommen werden können. Von einer solchen Reform der Reform sind und waren wir immer weit entfernt. Diejenigen, die den Ordo Missae Pauls VI. ablehnen, glitten dadurch, so argumentiert May, nicht in die Bindungslosigkeit ab, sondern blieben nur der bisherigen Bindung treu: „Auch sie wissen sich gebunden, aber nicht an den Ritus Pauls VI., sondern an jenen Pius‘ V.“ (ebd., a. a. O.).
Wer heute zu Mays Buch greift, dem wird deutlich: Die Liturgiereform wurde unter Prämissen und Umständen eingeführt, unter denen nicht die erforderliche Rechtssicherheit gewonnen werden konnte, mit ihr einem zweifelsfrei gerechten Gesetz gegenüberzustehen. Diejenigen, die an den bisherigen liturgischen Büchern und Riten festhielten, gingen sozusagen auf Nummer sicher, denn an deren Rechtgläubigkeit und Verbindlichkeit konnte kein auch nur annähernd vergleichbarer Zweifel bestehen. Selbst noch nach den Vorkehrungen, die mit Summorum Pontificum getroffen wurden, hat die nachkonziliare, sogenannte Liturgiereform eine quasi allgegenwärtige Diasporasituation geschaffen, in der jedenfalls niemand verpflichtet ist, bei physischer Unerreichbarkeit der überlieferten Messe zur Erfüllung der Sonntagspflicht die neue zu besuchen. Wenn es der einzelne (gegebenenfalls in Ausnahmefällen) trotzdem tun möchte und Priester findet, die den Novus Ordo in Übereinstimmung mit dem Glauben und der liturgischen Tradition der Kirche zu feiern sich bemühen, wird man dies, wenn man sich der sehr ausgewogenen Argumentation Mays anschließt, nicht prinzipiell zurückweisen können.
Diese Rezension erscheint während der Bischofssynode in Rom. Da möchte ich es nicht versäumen, abschließend zu bemerken, dass der Novus Ordo Missae nicht eingeführt worden wäre, hätte sich Paul VI. vom ablehnenden Votum der Bischofssynode 1967 leiten lassen, die die sogenannte Missa normativa, gleichsam den Prototyp des Novus Ordo, mit überwältigender Mehrheit zurückgewiesen hatte.
May, G., Die alte und die neue Messe. Die Rechtslage hinsichtlich des Ordo Missae, (Sarto) Stuttgart 2015, Paperback, 147 Seiten, ISBN 978-3-943858-69-3, Preis in Deutschland: € 9,10.
Foto: Ausschnitt des Covers von „Die alte und die neue Messe“ – Bildquelle: Sarto-Verlag
Womöglich vor mehr als zwanzig Jahren schon prägte der mittlerweile von Benedikt XVI. zum Apostolischen Protonotar erhobene Mainzer Kirchenrechtsprofessor Georg May mit Blick auf die Beichte das Wort vom „vergessenen“ oder „verlorenen“ Sakrament. Solcher Verlust war und ist kennzeichnend für die Jahrzehnte seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und beschränkt sich nicht auf das Bußsakrament, dessen Verschwinden und Vergessen eher Segment und Symptom ist für einen oft unmerklichen Verlust des Katholischen im Ganzen. Statt dies einzugestehen, wurde und wird seither, entgegen offenkundiger Statistik, oftmals noch von einem Aufbruch, von Neuentdeckung des Glaubens gesprochen, der dem Impuls des Zweiten Vatikanischen Konzils zu verdanken sei.
Gewisse Skepsis
Wegen des Untertitels: „Den christlichen Glauben neu entdecken“, den der Trierer Diözesanpriester und Münchner Pastoraltheologe Andreas Wollbold seinem Buch „Die versunkene Kathedrale“ gegeben hat, begann ich mit einiger Skepsis die Lektüre dieses Werkes, denn er erinnert mich unangenehm an die illusionierende Aufbruchterminologie, mit der die Ordinariatsgrößen landauf, landab den Niedergang verwalten, bis der Letzte das Licht ausknipst.
Als es 2013 im Illertissener Verlag Maria Media erschien, war Gerhard Ludwig Müller zwar schon Präfekt der Glaubenskongregation, hatte aber noch nicht den Purpur der Kardinäle empfangen. Trotzdem war das Vorwort, das der Erzbischof beisteuerte, eine offiziöse Leseempfehlung. Den Einstieg machte Müller mit einem Bildwort Benedikts XVI. aus der Eröffnungspredigt zum Jahr des Glaubens anlässlich des 50. Jahrestages des Beginns des Zweiten Vatikanischen Konzils. Darin verglich er die Situation seit dem Konzil mit einer Wüste (vgl. S. 9). Ein, obwohl der Sache nach bedauerlich, erfrischend klarer Realitätssinn, eben ganz anders als der blinde Erneuerungstaumel angeblicher Früchte und Aufbrüche infolge des Konzils. Eine Klarsicht Ratzingers, in der der 50. Jahrestag der Konzilseröffnung mehr als eine Gedächtnisstunde, denn als ein freudiges Jubiläum in die Bilanz der Kirche heute eintrat. Es ist bemerkenswert, dass der Präfekt der Glaubenskongregation diese Sichtweise in seinem Vorwort übernimmt, und dieses ist insgesamt als überaus positiv zu würdigen. Müller fragt treffend: „Das christliche Leben ist auch Glaubenspraxis: Gebet, Moral und sakramentales Leben. Ob nicht ein Teil der Verwüstung, von der Papst Benedikt spricht, daraus resultiert, dass die Glaubenspraxis als unwichtig abgetan wurde?“ (S. 11)
Versunkene Kathedrale
Nicht dem Wüstenbild Ratzingers schließt Wollbold sich an, sondern greift eine alte, bretonische Volkserzählung auf, die zuvor schon Claude Debussy musikalisch vertont hat. Wollbold dazu: „Von einer (…) Kathedrale, dem Dom der Stadt Ys in der Bretagne, erzählt nun aber eine Legende, sie sei eines Tages vom Meer verschlungen worden. Da kann man sich die Frage stellen: „Hat nicht das gleiche Schicksal die Kathedrale des Glaubens ereilt? In der Tat, bei vielen Christen ist der Glaube wie vom Erdboden verschluckt. Am Anfang haben sie vielleicht noch etwas vermisst. Doch das gibt sich mit der Zeit, denn auch bei religiösen Überzeugungen gilt: aus den Augen, aus dem Sinn.“ (S. 13) Wollbold ist aber nicht schwarzmalerisch, denn das Bild der versunkenen Kathedrale hat er deshalb übernommen, weil die Legende nicht im Versinken, sondern im intakten Wiederauftauchen der Bischofskirche von Ys kulminiert: „In der Bretagne erzählt man weiter: Eines Tages steigt die Kathedrale wieder vom Meeresgrund empor. Wie durch ein Wunder ist sie dabei nicht durch Schlamm, Tang, Algen und Muscheln entstellt, sondern sie ist schön wie am Tag ihrer Weihe. Geläut, Gebet und Gesang klingen auf, und das Haus Gottes erstrahlt in unvergleichlichem Glanz.“ (S. 14)
Aus Predigt und Katechese erwachsen
Wollbolds Buch ist, wie er selbst in der Einleitung darlegt, aus seiner Verkündigung in Predigt und Katechese hervorgegangen (vgl. S. 18), und bei der Lektüre fällt die glückliche Verbindung von inhaltlichem Anspruch, auf den ein Theologieprofessor nicht verzichten darf, mit der flüssigen und gutverständlichen Vermittlung auf, aus der die priesterliche Erfahrung eines gewissenhaften Seelsorgers spricht. Beides paart sich immer wieder mit erfrischendem Humor, der gleichsam beides verbindet: „’Man muss die Menschen dort abholen, wo sie stehen‘, so sagt man vielleicht in guter Absicht. Aber, wenn sie im Regen stehen, holt man sie doch zuerst einmal ins Trockene.“ (S. 15)
Mit der Architektur des Glaubens der Kirche wieder vertraut werden
Andreas Wollbold geht in verschiedenen Schritten vor, die gleichsam zuerst den Bauplan von Glaube und Kirche zeichnen, um sie auf Grundlage dieses Bauplans wiedererstehen zu lassen. Dabei geht es nicht um Neuaufbau aus alten Versatzstücken, nicht um eklektizistische Neugestaltung aus alten Bauelementen, die kreativ mit neuen verbunden werden oder in diesen überhaupt deplatziert und fremd wirken. Somit erst recht museal wirken würden wie unverstanden fremde Altertümer in futuristisch kalten Ausstellungsräumen, die vor allem die eigene Sterilität ausstrahlen. Nein, Wollbold hat die bretonische Legende wirklich bedacht und konsequent übernommen. Auch dort ersteht die alte Kathedrale, die die Fluten verschlangen, unversehrt und frisch und taucht in ihrem altehrwürdigen Glanz, unverwüstlich jugendlich, wieder auf. Nicht eine neue Kathedrale erhebt sich mit dem Wiederauftauchen, und auch wird nicht mit dem Bau eines neuen Domes, dem einstweiligen Verlust des alten ungeduldig vorgegriffen. Das apokalyptische Nichtwissen von Tag und Stunde wird zum Hoffnungsschimmer, demgegenüber man bereit und erwartungsvoll sein darf und geduldig sein muss.
Glaube und Vernunft
Ein erster Teil macht in drei Stufen Grundlagen des Glaubens bewusst, die nicht ohne Frage und Anspruch der Wahrheit gedacht werden können und ohne die deshalb der Glaubensakt und Glaubensvollzug selbst nicht möglich sind. Die natürliche Gotteserkenntnis ist dabei grundlegend, und doch ist glauben selbst nicht ein bloßes Meinen, auch nicht einfach die vielleicht intensivste Überzeugung oder subjektiv deutlichste Einsicht eines Menschen oder einer Gruppe, und ist es deswegen fraglich, ob es überhaupt möglich ist, den Glauben der Kirche und die Kirche als Glaubensgemeinschaft mit den sogenannten Religionen der Welt in eine Reihe zu stellen. Das zutreffende Wahrheitskriterium des Christentums ist genaugenommen nicht so sehr sein Unterscheidungsmerkmal zu den anderen Religionen, sondern vielmehr das formale Spezifikum seiner inhaltlichen Unvergleichbarkeit und Einzigartigkeit.
So betrachtet, stehen letztlich nicht viele falsche Religionen der wahren Religion gegenüber, sondern ist es eigentlich falsch, die eine Religion, die notwendigerweise mit dem Anspruch der Wahrheit und seiner Einlösung verbunden sein muss, mit den vielfältigen, menschlichen Äußerungen eines religiösen, oder noch richtiger, transzendenten Bedürfnisses zu einem Plural der Religionen zusammenzufassen, den es strenggenommen nicht gibt. Weicht man diesem Fehler aus, bestreitet man nicht das Bestehen von menschlichen Suchbewegungen, die insofern religiös sind, als ihr Ziel die eine Religion ist und akzeptiert grundsätzlich den Wert dieser Suchbewegungen, die wenigstens implizit auf das Ziel der Religion ausgerichtet sind (oder sein müssen), in der Wahrheitsanspruch und Einlösung dieses Anspruchs verbunden sind, um das Ziel ihrer Suche erreichen zu können, beziehungsweise, wenn sie es erfolgreich erreichen sollen (vgl. S. 19-50). Doch damit erreicht man zunächst nur eine natürliche Religion. Christlicher, katholischer Glaube jedoch ist Offenbarungsglaube.
Glaube und Offenbarung
Glaube ist Antwort auf einen Anruf in der Offenbarung, die mit dem Tode des letzten Apostels vollendet, aber in der Tradition und in der Heiligen Schrift bleibend in der Kirche präsent ist und so durch die Kirche der Welt vor Augen steht. Dieser Antwortcharakter des Glaubens bezeugt, dass die Glaubensinhalte nicht nur auf jene „Daten“ beschränkt sind, die sich natürlicher Gotteserkenntnis verdanken und die das Vatikanische Konzil von 1869/70 dogmatisch so sehr verteidigt hat. Zum katholischen Glauben gehören wesentlich auch Inhalte hinzu, die von Gott – auf der Grundlage der natürlichen Gotteserkenntnis – dem Menschen zu seinem Heil mitgeteilt werden, nicht jedoch auf dem Wege natürlicher Gotteserkenntnis, sondern durch Selbstmitteilung Gottes, die wir die Offenbarung Gottes nennen. In Jesus Christus als dem autoritativen Zeugen Gottes in der Welt, der gottmenschliches Selbstzeugnis gibt, hat diese Offenbarung ihren heilsgeschichtlichen Gipfelpunkt erreicht. Wollbold entwickelt diese Zusammenhänge anschaulich, umfassend und katechetisch in biblischer Fundierung (vgl. S. 50-77).
Bekenntnis zum Glauben der Kirche
Christlicher Glaube ist katholischer Glaube und als solcher kirchlicher Glaube. Er ist dem Einzelnen gar nicht möglich, nicht zuletzt aufgrund seiner vorher vorgestellten Offenbarungskomponente. Er ist folglich nicht Privatsache und nicht Sache des Einzelnen in Unmittelbarkeit zu einer diffusen Gottesvorstellung oder überhaupt unpersönlich wie in fernöstlichen Weltanschauungen, wie etwa dem Buddhismus – schon gar nicht in seiner esoterisch westlich popularisierten Gestalt. Ausdruck dieser Bindung an die Kirche findet der Glaube in den Glaubensbekenntnissen der Kirche. Und so wählt Wollbold anschließend die Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir auch als Rosenkranzcredo beten, als Leitfaden der weiteren Darstellung (vgl. S. 78-239), was den weitaus größten Teil des Buches einnimmt und sich nicht mit knappen Kommentierungen begnügt, sondern immer wieder Anknüpfungspunkte an die Glaubenspraxis der Kirche sucht und weiterführende Exkurse etwa zum Rosenkranz, zur Verehrung der Engel oder zur Rolle der Kirche einflicht, um unsystematisch drei Beispiele herauszugreifen.
Es ist im Rahmen einer Buchbesprechung nicht angebracht, hier den Durchgang durch das Apostolicum detailliert nachzuzeichnen, doch eine Bemerkung möchte ich machen. Sie betrifft den Glauben der Kirche an die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens. Diese erschöpft sich freilich nicht in einer biologischen Konstitution der Physis der Gottesmutter, Wollbold macht aber unmissverständlich deutlich, dass eine Spiritualisierung, die die körperliche Unversehrtheit der Jungfräulichkeit Mariens ausblendet, mit dem Glauben der Kirche unvereinbar ist (vgl. S. 140-144). Nachdem der nunmehrige Kardinal Müller das Buch mit einem Vorwort bedacht hat, kann man dieses in einem weiteren Sinne als eine Distanzierung des Präfekten der Glaubenskongregation von früheren, ungenügenden Aussagen zum Thema verstehen und anerkennen, für die seine Katholische Dogmatik (vgl. dort S. 498) zu Recht kritisiert worden ist, die zuerst unter seinem Namen und in seiner Verantwortung erschienen ist, als er Ordinarius für Dogmatik in München war und weiterhin erscheint, ohne bisher unter anderem im betreffenden Passus verbessert worden zu sein.
Vaterunser – Muster und Schule des Gebets
Wie zuvor anhand des Glaubensbekenntnisses folgt Andreas Wollbold abschließend, wenn auch knapper, dem Aufbau und der Struktur des Vaterunsers, um die Grundstruktur christlichen Betens zu vermitteln (vgl. S. 241-279). Der Englische Gruß und der Rosenkranz folgen. Der Sinn des Bittgebets wird erschlossen, der Rosenkranz vorgestellt (als Verknüpfung wichtiger Grundgebete), zur Einübung der Gewissenserforschung hingeführt. Mit diesem Teil des Buches wird also der Brückenschlag zu einem mittlerweile auch erschienen zweiten Band vollzogen, der den Titel: Licht für meine Pfade – Das christliche Leben neu wagen, trägt. Das Gebet ist der Atem des christlichen Lebens, in den sieben Vaterunserbitten fügen wir uns in den Atemrhythmus des Glaubens ein.
Band II folgt im Aufbau den Zehn Geboten Gottes, die der verdiente Tiroler Franziskaner P. Fridolin Außersdorfer (1909-2006) treffend den „Schatz vom Berge Sinai“ genannt hat. Diese Zehn Gebote sind die Handlungsvorgaben christlichen Lebens, dieses aber nicht Aktionismus und einfach moralische Leistung. Deswegen umfasst „Licht für meine Pfade“ in einem zweiten Teil die Sieben Sakramente und zeigt so auf, dass christliches Leben nicht aus eigener Kraft geführt werden kann, sondern aus dem sakramentalen Heilshandeln Gottes an den Getauften genährt wird, welches dieser durch die Kirche in den Seelen vollbringen will und das sie mit Glaubenskraft erfüllt, ein Gedanke, den Wollbold in einem Schlusskapitel von Band I schön zum Ausdruck bringt (vgl. S. 281-285). Auch dies eine klare Empfehlung, sich Band II nicht entgehen zu lassen.
Wollbold, A.
Die versunkene Kathedrale. Den Christlichen Glauben neu entdecken
(Media Maria) Illertissen 2013
gebunden, 285 Seiten
ISBN 978-3-9815698-5-8
Preis: EUR 19,95
Foto: Die versunkene Kathedrale – Bildquelle: Media Maria
Vatikan (kathnews/RV). Für den Papst gibt es am Dienstagabend ein Konzert. Die Violinistin Arabella Steinbacher spielt vor Papst Benedikt XVI. in dessen Sommerresidenz Castelgandolfo. Auf dem Programm der 29-jährigen Musikerin stehen Werke von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi. Bei dem Konzert im Innenhof des Palais wird auch der Bruder des Papstes, Georg Ratzinger, anwesend sein. Gemeinsam mit Oboist und Dirigent Albrecht Mayer und seinem Ensemble New Seasons führt Steinbacher unter anderem das Konzert für Violine, Oboe, Streicher und Basso Continuo (BWV 1060) von Bach auf. Der 46-jährige Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker Mayer war bereits im Sommer 2009 vor dem Oberhaupt der katholischen Kirche aufgetreten, damals mit dem Bayerischen Kammerorchester Bad Brückenau.